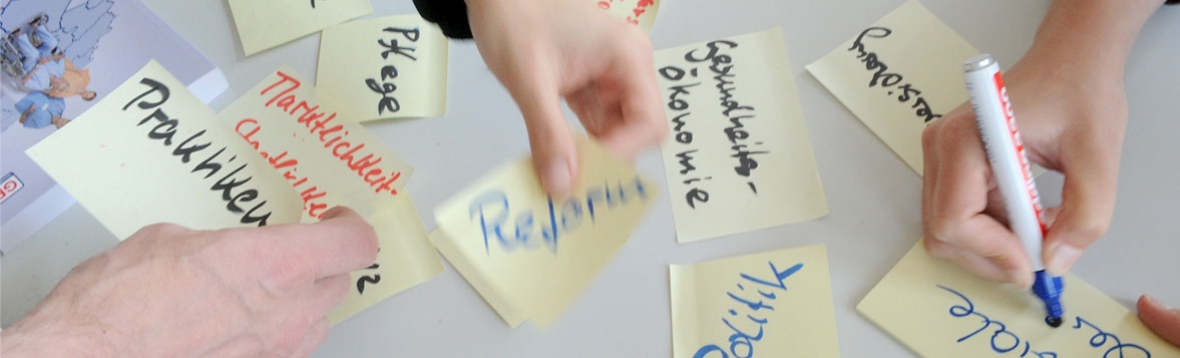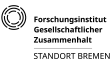Technologische Innovationen in der Pflege: Cluster "Zukunft der Pflege" geht in die nächste Runde
Die Pflege durch den Einsatz digitaler Lösungen verbessern und gleichzeitig die Belastung des Pflegepersonals reduzieren – das ist das Ziel des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Forschungsclusters "Zukunft der Pflege“. Dieses geht nun in die zweite Förderphase über, in der der Transfer neuer Technologien in die Praxis im Mittelpunkt steht. Ein wichtiger Baustein ist dabei das Pflegeinnovationszentrum (PIZ) in Oldenburg und Bremen.
Die Pflege in Deutschland steht vor enormen Herausforderungen: Eine stark steigende Zahl Pflegebedürftiger trifft auf einen eklatanten Mangel an Fachkräften. Gleichzeitig werden pflegerische Interventionen immer komplexer. Um diesen Problemen zu begegnen, unterstützt das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) die Entwicklung und Erforschung neuer Pflegetechnologien.
Im Rahmen des Clusters „Zukunft der Pflege“ werden seit 2017 soziale und technische Innovationen in der Pflege zusammengebracht: Forschung, Wirtschaft und Pflegepraxis arbeiten gemeinsam mit Anwender:innen an neuen Produkten, die den Pflegealltag in Deutschland erleichtern und verbessern sollen. Als erster Baustein des Pflegeclusters nahm im Juni 2017 das bisher in Deutschland einmalige Pflegeinnovationszentrum (PIZ) seine Arbeit auf. Hier erforschen Ingenieur:innen des OFFIS in Oldenburg gemeinsam mit Pflegewissenschaftler:innen (Prof. Dr. Karin Wolf-Ostermann, Institut für Public Health und Pflegeforschung), und Pflegeökonom:innen (Prof. Dr. Heinz Rothgang, SOCIUM Forschungszentrum Ungleichheit und Sozialpolitik) der Universität Bremen neue Technologien. Dabei spielen auch ethische, soziale und rechtliche Aspekte eine zentrale Rolle, die von der Universität Oldenburg in den Blick genommen werden.
Nach der erfolgreichen ersten Phase geht das Forschungsprojekt nun in die zweite Runde über, in der das Cluster zu einem „Innovations- und Transferhub“ ausgebaut werden soll. Während bisher die Entwicklung und Erprobung neuer Technologien im Mittelpunkt stand, soll nun der Transfer in die breite Praxis forciert werden. Dazu gehören beispielsweise robotische Systeme zur physischen Entlastung des Pflegepersonals bei körperlich belastenden Tätigkeiten oder auch Technologien zur Unterstützung der telepflegerischen Versorgung, zum Beispiel durch sensorische Erfassung des Gesundheitszustands.
Die Universität Bremen bringt dabei umfassende Expertise der Pflegeforschung, der Pflegeökonomie und der Versorgungsforschung mit einem besonderen Fokus auf digitale Pflege-Technologien ein. „Technologische Innovationen können den Alltag in der Pflege entlasten, aber sie müssen sinnvoll in die Versorgungspraxis und in die Arbeit der Pflegekräften integrierbar sein,“ sagt Prof. Dr. Karin Wolf-Ostermann. Die Bremer Wissenschaftler:innen analysieren unter anderem die Bedarfe an technologischer Unterstützung in unterschiedlichen ambulanten und stationären Pflegesituationen, sie untersuchen wie technologische Innovationen wie Smartwatches und andere „Wearables“ in den Pflegealltag integriert werden können und beschäftigen sich mit Fragen rund um die Evaluation des Technologieeinsatzes. „Mit unseren Erfahrungen, Forschungsschwerpunkten und Netzwerken können wir darüber hinaus eine vermittelnde Rolle zwischen den Bedarfen und Anforderungen in der Pflegepraxis, den Interessen von Entwickler:innen und der Wissenschaft einnehmen“, sagt Prof. Dr. Heinz Rothgang.
Insgesamt wird das Cluster „Zukunft der Pflege“ in den kommenden fünf Jahren mit rund 20 Millionen Euro gefördert. Teil des Vorhabens sind neben dem PIZ vier sogenannte „Pflegepraxiszentren“ (PPZ) in Berlin, Freiburg, Hannover und Nürnberg, denen eine wichtige Rolle in der Implementation und Evaluation der Technologien und Produkte zukommt.