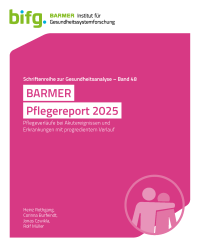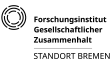Prof. Rothgang stellt BARMER-Pflegereport in Berlin vorDie steigende Zahl der Pflegebedürftigen ist insbesondere auf die Leistungserweiterung der Pflegeversicherung und nur zu einem geringen Anteil auf demografische Alterung zurückzuführen. Zu diesem Fazit kommt der neue Pflegereport, den das SOCIUM der Uni Bremen im Auftrag der BARMER erstellt hat.
Der jährlich veröffentlichte BARMER-Pflegereport bewertet die aktuelle Pflegepolitik und erfasst die Situation der Pflege. Für den Bericht werteten Professor Heinz Rothgang, Corinna Burfeindt, Dr. Jonas Czwikla und Dr. Rolf Müller vom SOCIUM der Universität Bremen Daten aus der Pflege- und Kassenstatistik sowie der BARMER umfassend aus.
Die steigende Anzahl der Pflegebedürftigen ist insbesondere auf die Leistungsausweitungen der Pflegeversicherung zurückzuführen
Seit etwa zehn Jahren steigt die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland rasant an: So hat sich der Anteil der Pflegebedürftigen an der Bevölkerung nach Auswertung der BARMER-Daten von 3,21 Prozent im Jahr 2015 auf 6,24 im Jahr 2023 annähernd verdoppelt. Nur rund 15 Prozent dieses Anstiegs lässt sich jedoch durch demographische Entwicklungen erklären.
Das diesjährige Schwerpunktkapitel des Berichtes untersucht deshalb, inwieweit der Anstieg durch eine erhöhte Anzahl von Krankheitsfällen erklärt werden kann. Bei den Erkrankungen wird unterschieden zwischen akuten Ereignissen wie ein Schlaganfall oder eine Krebsdiagnose, die die Angehörigen vor plötzliche Entscheidungsnotwendigkeiten stellen, und langsam schleichenden Veränderungen bei fortschreitenden Erkrankungen wie Parkinson, die von Angehörigen erst über die Zeit als herausfordernd oder überfordernd erkannt werden. Wie wahrscheinlich es ist, innerhalb der ersten zwölf Monate nach der Diagnose pflegebedürftig zu werden, hängt von der Art der Erkrankung ab.
Je nachdem, wie plötzlich die pflegebegründenden Ereignisse eintreten, kann dies zwar einen Effekt auf die Art der Versorgung und auf die Dauer der Pflegebedürftigkeit haben. Die Gründe für die steigende Zahl an Pflegebedürftigen liegen jedoch vielmehr jenseits der Entwicklung der Demografie und Krankheitsgründen. Die steigende Anzahl Pflegebedürftiger ist insbesondere auf die Ausweitungen der Leistungen der Pflegeversicherung und der Zugangsberechtigungen zu diesen Leistungen zurückzuführen. Die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs im Jahr 2017, der auch Menschen mit Demenz und anderen kognitiven beziehungsweise psychischen Einschränkungen besser berücksichtigt, hat entscheidend zu diesem Anstieg beigetragen. Dieser Befund ist insbesondere deshalb auch politisch von Bedeutung, weil die Bundesregierung ausdrücklich vorgesehen hat, dass die geplante „große Pflegereform“ nur demographisch bedingte Ausgabensteigerungen enthalten darf. Wenn demographische Faktoren aber eine untergeordnete Rolle beim Ausgabenanstieg spielen, impliziert diese Setzung der Bundesregierung letztlich Leistungskürzungen.
Finanzierungsprobleme der Pflegeversicherung bleiben bestehen, konkrete Reformvorschläge bisher aus
Die Finanzierungsprobleme der Pflegeversicherung bleiben weiterhin bestehen. Die Eigenanteile in der Heimpflege betragen im ersten Jahr der Heimpflege inzwischen bundesdurchschnittlichen mehr als 3.100 Euro – und liegen damit weit jenseits dessen, was Pflegebedürftige mit durchschnittlichen Alterseinkünften finanzieren können. Die Pflegeversicherung droht nach Einschätzung der Autor:innen des Reports damit ihr selbstgestecktes Ziel, Verarmung durch Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zunehmend zu verfehlen. Gleichzeitig drohe der Pflegeversicherung bereits in diesem Jahr ein Defizit, das im nächsten Jahr weiter steigen wird. Im Koalitionsvertrag der Bunderegierung ist die Einsetzung einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe verabredet, die die Grundlagen einer „großen Pflegereform“ erarbeiten soll. „Der Beitragssatz der Pflegeversicherung ist in den in den letzten Jahren bereits in immer kürzeren Abständen erhöht worden. Die Politik muss Möglichkeiten finden, die Eigenanteile effektiv zu reduzieren und zu begrenzen, ohne den Beitragssatz anzuheben“ sagt Professor Heinz Rothgang. „Es liegt eine Vielzahl an Vorschlägen zur Begrenzung der Eigenanteile durch Veränderungen des Leistungsrechts und der Finanzierungsregeln innerhalb der bestehenden Sozialversicherung vor, die von der Politik aufgegriffen und geprüft werden müssen“, so der Pflegeökonom weiter.
Link zum BARMER-Pflegereport 2025.
Kontakt:Prof. Dr. Heinz RothgangSOCIUM Forschungszentrum Ungleichheit und Sozialpolitik
Mary-Somerville-Straße 3
28359 Bremen
Tel.: +49 421 218-58557
E-Mail:
rothgang@uni-bremen.de