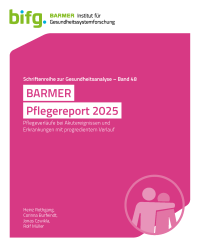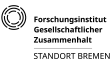Welcher Klimatyp bist du? Was verbindet dich mit anderen? Probiere es hier aus: www.fgz-risc.de/klimatypenrechner
Der Klimatypenrechner wurde auf Grundlage der Ergebnisse des Zweiten Zusammenhaltsberichts erarbeitet, der am 13.11.2025 auf einer Bundespressekonferenz vorgestellt wurde (wir berichteten). Begleitet wurde die Veröffentlichung mit einer erfolgreichen bundesweiten Plakatkampagne.
Die Forscher am FGZ identifizieren fünf Gruppen: Entschlossene (18%), Besorgte (18%), Zustimmende (31%), Indifferente (25%) und Ablehnende (8%).
Die Ablehnenden kritisieren Klimapolitik und fürchten wirtschaftliche Folgen. Die Entschlossenen sind von der Dringlichkeit umfassender Maßnahmen überzeugt. Dazwischen stehen die Besorgten. Sie teilen das Klimabewusstsein der Entschlossenen – und die wirtschaftlichen Sorgen der Ablehnenden. Das macht sie zu einer Schlüsselgruppe.
Der Zweite Zusammenhaltsbericht des FGZ zeigt, dass der Großteil der Bevölkerung die Gefahren des Klimawandels anerkennt und sich mehr Klimaschutz wünscht. Gleichzeitig machen sich viele Menschen aber Sorgen um die Folgen von Klimapolitik. Nur 8 Prozent lehnen eine ökologische Transformation ab.
83 Prozent der Befragten sorgen sich um die Folgen des Klimawandels. 71 Prozent sind der Meinung, dass die Politik noch mehr zur Bekämpfung des Klimawandels tun müsste. Aber: 49 Prozent fürchten Jobverluste durch Klimapolitik. 42 Prozent haben Angst um ihren Lebensstandard.
„Es geht bei der Transformation weniger um das ‚Ob‘ als um das ‚Wie‘“, sagt FGZ-Direktor und Mitherausgeber der Studie Prof. Dr. Olaf Groh-Samberg. „Wir finden in unseren Auswertungen eine Gruppe, die sehr deutlich die Risiken und Gefahren des Klimawandels anerkennt, sich aber zugleich stark um die sozialen Folgen von Klimapolitik sorgt.“
Klimapolitik muss soziale Ungleichheiten mitdenken
Die Besorgten könnten die Transformation mittragen – wenn ihre sozialen Sorgen ernst genommen werden. Die Bereitschaft in der Bevölkerung ist da: 53 Prozent sind überzeugt, dass es eine grundlegende Veränderung des Wirtschaftssystems bräuchte, um den Klimawandel zu bekämpfen. Entschlossene und Besorgte eint die Forderung nach Umverteilung und sozialem Ausgleich.
Kleine Gruppe, große Wirkung
Die 8 Prozent Ablehnenden sind politisch aktiv. Ihre Positionen werden in sozialen Medien verbreitet – oft mit Falschinformationen. Das könnte ein Grund dafür sein, warum 70 Prozent befürchten, Klimapolitik verschärfe gesellschaftliche Konflikte. „Wenn die Haltung der Ablehnenden als weit verbreitet gilt, erscheint ambitionierte Klimapolitik als Bedrohung für den Zusammenhalt“, sagt Olaf Groh-Samberg.
Einzigartige Datenbasis
Der Zusammenhaltsbericht nutzt verschiedene Datenquellen zur Analyse des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Die repräsentative Studie „German Social Cohesion Panel“ (SCP) stützt sich dabei auf die Befragung von über 8.000 Personen in ganz Deutschland, die Ende 2022 durchgeführt wurde. Die Ergebnisse unserer Studie bilden zentrale gesellschaftliche Konstellationen ab, deren Entwicklung wir fortlaufend beobachten und weiter auswerten. Aktuelle Daten bestätigen, dass Klimaschutz in der Bevölkerung weiterhin einen hohen Stellenwert hat.
„Mit unseren Daten können wir die Einstellungen zum Klimawandel in der Bevölkerung nicht nur in Bezug auf den sozio-demografischen Hintergrund der Befragten analysieren. Wir können sie auch mit gesellschaftspolitischen Einstellungen, Erfahrungen von Zusammenhalt im Alltag und dem Vertrauen in politische Institutionen in Beziehung setzen“, erklärt Mitherausgeber Dr. Nils Teichler.
Der vollständige Zusammenhaltsbericht steht hier zum Download bereit.